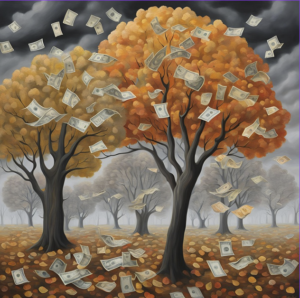Unser Verein hat ein spielfreies Wochenende. Zeit, sich auch einmal über ein anderes wichtiges Thema Gedanken zu machen. Den Profifußball im Allgemeinen und unsere Nationalmannschaft im Speziellen. Sportliches Aushängeschild unseres Landes, deren Funktion und Selbstverständnis. Einerseits auf der Ebene der Kommerzialisierung und Globalisierung, andererseits im Bereich der Identifikation.
Wie könnte man die Auswüchse des heutigen Profifußballs beseitigen?
Der Profifußball hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem Volkssport zu einem globalen Milliardengeschäft gewandelt. Wo einst Leidenschaft und lokale Verbundenheit im Vordergrund standen, dominieren heute Geld und Politik das Spielfeld. Investoren aus aller Welt, überhöhte Transfersummen, politisch motivierte Sponsoren und eine mediale Inszenierung, die oft mehr Show als Sport ist, haben den Fußball von seinen Wurzeln entfremdet. Doch wie kann man diese Auswüchse eindämmen und den Sport wieder in seine ursprüngliche Bahn lenken?
Ein erster Schritt wäre die Eindämmung der finanziellen Exzesse. Die Einführung eines verbindlichen Gehalts- und Transferoberlimits für Vereine könnte verhindern, daß der Markt von wenigen Superclubs mit unerschöpflichen Ressourcen beherrscht wird. Die UEFA könnte hier mit einer verschärften Financial-Fair-Play-Regelung vorangehen, die nicht nur auf Schuldenbegrenzung abzielt, sondern auch die Einnahmen- und Ausgabenstruktur transparenter und fairer gestaltet. Überschüssige Gelder könnten in Nachwuchsförderung und kleinere Vereine fließen, um die Basis zu stärken.
Zweitens muss die politische Einflussnahme begrenzt werden. Staaten oder staatsnahe Konzerne, die Vereine als Prestigeobjekte oder Propaganda-Instrumente nutzen, verzerren den Wettbewerb. Ein Lösungsansatz wäre ein unabhängiges Gremium, das Sponsorenverträge prüft und Deals mit klarer politischer Agenda ablehnt. Gleichzeitig sollten Verbände wie FIFA und UEFA ihre eigenen Regeln und Satzungen reformieren – etwa durch demokratischere Wahlen und weniger Abhängigkeit von mächtigen Einzelakteuren –, um Korruption und Machtspiele zu minimieren.
Drittens braucht es eine Rückbesinnung auf die Fans, die oft nur noch als zahlende Kundschaft gesehen werden. Günstigere Tickets, mehr Mitbestimmung bei Vereinsentscheidungen – etwa durch gewählte Pflicht-Fanvertreter im Aufsichtsrat – und ein Verbot von Spielen in Drittstaaten könnten die Bindung zwischen Clubs und Anhängern festigen. Der Profifußball lebt von der Atmosphäre in den Stadien, nicht von sterilen Events vor handverlesenem Publikum.
Schließlich sollte der sportliche Kern wieder Vorrang bekommen. Weniger überflüssige Wettbewerbe, dafür mehr Fokus auf regionale Ligen und traditionelle Duelle könnten die Identität des Fußballs stärken. Mediale Überhype und politische Gesten, die den Sport überlagern, sollten zurückgefahren werden – etwa durch klare Regeln, die den Fokus auf das Spiel lenken.
Die Beseitigung dieser Auswüchse erfordert Mut und Kooperation zwischen Verbänden, Vereinen und Fans. Es geht nicht darum, den Fortschritt aufzuhalten, sondern den Fußball wieder zu einem Sport zu machen, der Menschen verbindet – nicht nur Konten füllt oder politische Interessen bedient. Nur so kann der Profifußball seine Seele zurückgewinnen. Zusammenfassend bedarf es also einer Mischung aus konkreten Maßnahmen und einer grundsätzlichen Vision, um die genannten Probleme anzugehen, ohne den Realitäten des modernen Fußballs völlig zu widersprechen.
Der deutsche und internationale Länderspielfußball befindet sich in beängstigender Talfahrt. Nicht die Clubebene; sie funktioniert noch einigermaßen und hat mit der Verteilung der Mediengelder noch ausreichend zu tun. Die großen europäischen Fußballnationen sind in Auflösung begriffen. Die Fans der einzelnen „Nationalmannschaften“ erkennen ihre Teams kaum noch. Zu Europa- und Weltmeisterschaften, zeitversetzt im Vier-Jahres-Rhythmus einschließlich der Qualifikationsspiele, gesellt sich seit 2018 die Nations Leaque. Sie soll den Zeitraum zwischen den etablierten Turnieren mit Fußball auf Kontinentalebene ausfüllen und gibt den Länderfußball damit einer gewissen Beliebigkeit Preis.
Hier verstärkt sich die Unkultur, Nationalteams als Projektionsfläche einer Wokness- und Kniefallkultur einer globalen gesellschaftspolitischen Agenda zu mißbrauchen. Dort, wo nationale Identifikation verlorengeht, verkommt Länderfußball zur Beliebigkeit. Ungarn, Polen, Serbien, Rumänien und einige osteuropäische Fußballnationen halten diesem Trend in Europa noch etwas entgegen. In Südamerika stellen sich solche Fragen gar nicht erst. Ehemalige Kolonialmächte wie Frankreich, England oder Holland begannen schon vor Jahrzehnten, gute Fußballer aus ihren (ehemaligen) Kolonien einzubinden und die Definition von „Nation“ so zu erweitern. Andere Länder zogen nach und bürgerten gute Fußballer ein. Wer eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, hat die Wahl, für welches Land er aufläuft. Brasilien oder Spanien, wie im Fall Diego Costa, der Ex-Schalker Jermain Jones für Deutschland und später die USA. Ein frühes prominentes Beispiel ist die ungarische Legende Ferenc Puskas, welcher in den Nachkriegsjahren die damals legendären Ungarn aufs Feld führte und im Herbst seiner Karriere noch viermal für Spanien auflief. Die Ungarn haben es ihm offenbar verziehen, wenn sie das größte und bekannteste Stadion des Landes nach ihm benennen.
Wo Fußball immer eine Projektionsfläche nationaler Identifikation, Nationalstolz und gelebter Rivalitäten war, hat sich der heutige Länderfußball zum Catwalk für den eigenen Marktwert, gesellschaftspolitischer, propagandistischer (man denke nur an die Impfkampagnen) und sogar religiöser Botschaften entwickelt. Die Auswüchse sehen wir dann z.B. in Islambotschaften eines Antonio Rüdiger, bei demonstrativem Ramadan-Fastenbrechen während einer Pressekonferenz oder der Tatsache, daß das Länderspiel Belgien gegen Israel nicht mehr in Brüssel, sondern nur noch in Osteuropa gefahrlos durchführbar ist. Die letzten Spiele der Israelis in Westeuropa waren von Ausschreitungen militanter Muslime begleitet. Der Ausschluß Russlands und Weißrusslands aus den internationalen Wettbewerben erinnert derweil an dunkle Zeiten des kalten Krieges. Und als wären der Probleme nicht schon genug, werden vollkommen weltfremd sogar erste Forderungen nach gemischten Frauen- und Männermannschaften in den Raum gestellt.
Es ist nicht mehr weit und die Auflösung der Nationalmannschaften wird von ganz Übereifrigen gefordert. Es sind die politisch und medial beförderten Auflösungserscheinungen der einzelnen Staaten, ganz vorne dabei Deutschland, die hier in den sportlichen Bereich durchschlagen.
Man will das so. Der Stolz einer jeden Nation drückt sich auch über seinen Nationalsport aus, mehr noch als über seine anderen kulturellen Besonderheiten. Dies wird jedoch politisch/medial regelrecht unterdrückt! Das Schwenken von deutschen Fahnen wird als „rechts“ gebrandmarkt, da nationale Identifikation nicht mehr erwünscht ist. Anfeuerungsrufe wie unser in Dresden rhythmisch beklatschtes „Alles für Dresden“ sind auf unsere Nationalmannschaft gar nicht übertragbar, ohne daß die Staatsanwaltschaften den deutschen Fanblock mit Strafbefehlen überziehen würden. Wenn sich die Fanszenen nicht nachdrücklich dagegen wehren, wird dieser Prozess so weitergehen und der Fußball, wie wir ihn kennen und lieben gelernt haben, dem Untergang geweiht sein.